
© YAKOBCHUK VIACHESLAV | shutterstock.com
24. November 2017
Bitte was? – 10 Wörter die dir nur im Studium begegnen
Da hast du deine Fachhochschulreife endlich in der Tasche, und damit bewiesen das du nicht auf den Kopf gefallen bist, und dann das: Du kommst an die Uni und verstehst plötzlich nur noch Bahnhof. Welche Sprache sprechen diese Akademiker bloß?
Ja, eine Hochschule hat ihre ganz eigenen Vokabeln, die du vermutlich erst lernen musst. Aber hast du sie einmal verinnerlicht, ist es wie mit jeder Fremdsprache: Aus Worten werden Bilder und du wirst das Kauderwelsch deiner „Kommilitonen“ verstehen – und sogar selbst sprechen. Um dir den Anfang ein wenig zu erleichtern hier die Top Ten der akademischen „Fachbegriffe“ – und einige weitere die damit zusammenhängen – inklusive „Übersetzung“, alphabetisch sortiert.
1. Akademische Viertelstunde
Auch oder vielleicht sogar besser bekannt unter der Abkürzung c. t. (cum tempore – Latein „mit Zeit“). Ein solcher Vermerk hinter der Uhrzeit sagt dir, dass es eigentlich erst eine Viertelstunde später losgeht. Beginn 10 Uhr c. t. bedeutet übersetzt: Beginn 10:15 Uhr. Ihren Ursprung hat die Akademische Viertelstunde wohl in der Zeit, als die Studenten noch keine Uhren besaßen und sich am Glockenschlag der Kirchturmuhren orientierten. Nachdem dieser erklungen war, sollten 15 Minuten reichen, um rechtzeitig zur Vorlesung zu kommen. Eine weitere Erklärung lautet: Ursprünglich wiederholte jeder Dozent zu Beginn der Vorlesung den Stoff der letzten. Wer davon überzeugt war diesen bereits zu beherrschen, durfte etwas später kommen. Achtung! Heißt es nicht c. t., sondern s. t. (sine tempore – „ohne Zeit“) musst du pünktlich sein. Nebenbei bemerkt ist eine Vorlesung eine Lehrveranstaltung bei der der Dozent vor den Studenten referiert, während diese lediglich zuhören müssen.
2. Audimax
Eine gebräuchliche Abkürzung für das lateinische Auditorium maximum, was nichts anderes ist als der größte Hörsaal einer Hochschule – Hörsaal übrigens ein weiteres klassisches Wort, das die Räumlichkeiten bezeichnet, in denen die Vorlesungen gehalten werden. Bequeme Sitzmöglichkeiten – eher Fehlanzeige. Nichtsdestotrotz wird das Audimax auf Grund seiner schieren Größe gerne auch für Vorträge, Konzerte oder Filmvorführungen genutzt.
3. Belegbogen
Der Belegbogen! Ein Tummelplatz der interessanten Vorlesungen und Seminare eines Semesters, bei denen du gerne zugehört und mitgemacht hättest, es zeitlich nicht geschafft hast, von denen du aber dennoch behauptest, sie besucht zu haben. Deine Angaben werden nicht nachgeprüft und das, obwohl diese Listen in deinem Studienbuch abgelegt sein müssen, das du zum Ende deines Grundstudiums und vor deinen Abschlussprüfungen vorlegen musst. Viel wichtiger sind deine darin abgehefteten Scheine, also die meist benoteten Leistungsnachweise, die du dir durch Hausarbeiten und Klausuren in den Seminaren erarbeitet hast.
4. Campus
Lateinisch für „Feld“ ist mit dem Wort Campus das Universitätsgelände gemeint. Denn häufig sind die unterschiedlichen Hochschulgebäude zentral beieinander angesiedelt. Kurze Wege für schnelle Ortswechsel. Ob die Umgebung schön und einladend ist oder eher abschreckend wirkt, ist unterschiedlich. Allerdings gibt es auch Bildungsstätten, deren einzelne Fakultäten über die ganze Stadt verteilt sind und die somit keinen „echten“ Campus haben. Fakultäten sind übrigens Verwaltungseinheiten, gegliedert nach den einzelnen Wissenschaftsbereichen der Uni. Sie sind zuständig für die Organisation des Studiums, der Lehre und der Forschung in ihren jeweiligen Fachgebieten.
5. Hiwi
Sinnigerweise müsste es eher „Wihi“ heißen, da es sich um die umgangssprachliche Abkürzung für „wissenschaftliche Hilfskraft“ handelt. Sie unterstützen die Dozenten bei ihrer Arbeit durch Recherchedienste, etc. oder übernehmen Tätigkeiten im Service, etwa in den Bibliotheken. Unterteilt in mit und ohne Abschluss sind Hiwi-Stellen äußerst beliebt, weil sie einem bereits einen ersten Blick hinter die Kulissen akademischer Lehre und Forschung erlauben. Zudem lassen sie sich meist gut mit dem Studium vereinen, sodass du dir nebenher noch etwas Geld dazuverdienen kannst. Voraussetzung ist: Du musst immatrikuliert sein und wenn möglich schon ein paar Semester hinter dir haben. Was uns direkt zum nächsten Wort bringt.
6. Immatrikulation
Immatrikulation nennt man die Einschreibung, nach der du offiziell dein Studium antreten kannst. Dazu brauchst du diverse Unterlagen wie Personalausweis und Zeugnis. Bitte bloß nichts vergessen! Die Schlange ist meist recht lang und du willst dich doch nicht wieder hinten anstellen müssen. Außerdem gibt es gewisse Fristen, die du wahren musst. Warst du erfolgreich, bist du anschließend stolzer Besitzer eines Studierendenausweises mit deiner persönlichen Matrikelnummer. Sie ist quasi deine „Hundemarke“ und begleitet dich durch dein ganzes Studium. Los wirst du sie erst wieder, wenn du dich exmatrikulierst, also ausschreibst. Dann wirst du von der Liste der Studenten gestrichen. Das ist der Fall, wenn dein Studium beendet ist, du es abbrichst oder zwangsweise, solltest du etwa verpasst haben deine Semestergebühren zu entrichten.
7. Kolloquium
Eine Art der Lehrveranstaltung meist für Studenten im fortgeschrittenen Semester (ein Studienhalbjahr). Nicht selten dürfen Kolloquien nur auf Einladung des abhaltenden Professors besucht werden. Wie der Name schon sagt (colloquium = „Gespräch“, „Unterredung“) wird in einer Art Gesprächs- oder Diskussionsrunde ein zuvor vorgestelltes Thema näher erörtert. Als Vorbereitung auf die Abschlussarbeit oder –prüfung nahezu unerlässlich.
8. Kommilitonen
Auch hinter diesem Wort, das nichts weiter als deine Mitstudenten bezeichnet, verbirgt sich ein lateinischer Ursprung. „Commilito“ bedeutet übersetzt „Mitstreiter“, „Weggefährte“ oder „Kriegskamerad“. Gemeint ist also eine zusammengehörende Gruppe, die sich von den Studienkollegen im selben Kurs bis hin zu allen Studierenden der Uni erstrecken kann. Bereits im 16. Jahrhundert war der Begriff Kommilitone fest in der Studentensprache verankert. Im 20. Jahrhundert entstand dann auch eine weibliche Version, die Kommilitonin.
9. Prüfungsordnung
Die Prüfungsordnung ist quasi die Bibel des Studenten. Denn sie weiß Rat in allen Lebenslagen und eine Antwort auf alle Fragen. So sagt sie dir nicht nur, welche Prüfungen du ablegen musst und wie der genaue Ablauf ist, sondern auch wie deine schriftliche Abschlussarbeit auszusehen hat, welche Scheine du zuvor vorlegen musst und wie lange die Regelstudienzeit für dein Fach oder deine Fächer ist. Das ist die Zeit, in der du dein Studium idealerweise absolviert haben solltest. In der Praxis sieht es jedoch meist anders aus. Viele Studierende brauchen länger – aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber keine Angst, es handelt sich dabei – wie gesagt – eher um eine Richtlinie, die du mit Abschaffung der Studiengebühr ohne schlechtes Gewissen überschreiten darfst.
10. Vorlesungsverzeichnis
DER Bestseller vor Beginn eines jeden neuen Semesters ist das kommentierte Vorlesungsverzeichnis, kurz KVV. Schließlich verschafft dir seine Lektüre den genauen Überblick über sämtliche Vorlesungen und Kurse, die angeboten werden. Welcher Dozent, wann, wo, was von dir erwartet wird, Literaturtipps zur Vorbereitung und – ganz wichtig – bis wann du dich angemeldet haben musst, steht alles drin. Auch wie viele Credit Points (ECTS = European Credit Transfer System) eine Veranstaltung bringt, ist vermerkt. Dieses Punktesystem erlaubt eine „Umrechnung“ und damit die Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen. An dieser Stelle ein Tipp für Erstsemester und alle, die es nicht besser wissen: Es reicht vollkommen, wenn du dir die Exemplare deiner Fächer besorgst. Du musst nicht das Komplettwerk nehmen, in dem die Veranstaltungen aller Studiengänge aufgelistet sind.
Natürlich ist der „Hochschulslang“ mit diesen zehn Wörtern nicht einmal annähernd ausgeschöpft, sie sollten jedoch reichen, damit du dich in deiner Anfangszeit problemlos zurechtfindest und nicht sofort als „Ersti“ erkannt wirst. Einmal verinnerlicht werden sie dich durch dein ganzes Leben begleiten, auch wenn du außerhalb des Studiums nicht viel mit ihnen anfangen kannst. Zum Angeben sind sie allemal gut. Sollte beispielsweise einer deiner immatrikulierten Kommilitonen beim Kolloquium im Audimax auf dem Campus behaupten Latein sei eine tote Sprache, kannst du ihn sogleich eines Besseren belehren.
Uni-ABC Teil 1: Von A wie Asta bis H wie Hiwi
Ja, eine Hochschule hat ihre ganz eigenen Vokabeln, die du vermutlich erst lernen musst. Aber hast du sie einmal verinnerlicht, ist es wie mit jeder Fremdsprache: Aus Worten werden Bilder und du wirst das Kauderwelsch deiner „Kommilitonen“ verstehen – und sogar selbst sprechen. Um dir den Anfang ein wenig zu erleichtern hier die Top Ten der akademischen „Fachbegriffe“ – und einige weitere die damit zusammenhängen – inklusive „Übersetzung“, alphabetisch sortiert.
1. Akademische Viertelstunde
Auch oder vielleicht sogar besser bekannt unter der Abkürzung c. t. (cum tempore – Latein „mit Zeit“). Ein solcher Vermerk hinter der Uhrzeit sagt dir, dass es eigentlich erst eine Viertelstunde später losgeht. Beginn 10 Uhr c. t. bedeutet übersetzt: Beginn 10:15 Uhr. Ihren Ursprung hat die Akademische Viertelstunde wohl in der Zeit, als die Studenten noch keine Uhren besaßen und sich am Glockenschlag der Kirchturmuhren orientierten. Nachdem dieser erklungen war, sollten 15 Minuten reichen, um rechtzeitig zur Vorlesung zu kommen. Eine weitere Erklärung lautet: Ursprünglich wiederholte jeder Dozent zu Beginn der Vorlesung den Stoff der letzten. Wer davon überzeugt war diesen bereits zu beherrschen, durfte etwas später kommen. Achtung! Heißt es nicht c. t., sondern s. t. (sine tempore – „ohne Zeit“) musst du pünktlich sein. Nebenbei bemerkt ist eine Vorlesung eine Lehrveranstaltung bei der der Dozent vor den Studenten referiert, während diese lediglich zuhören müssen.
2. Audimax
Eine gebräuchliche Abkürzung für das lateinische Auditorium maximum, was nichts anderes ist als der größte Hörsaal einer Hochschule – Hörsaal übrigens ein weiteres klassisches Wort, das die Räumlichkeiten bezeichnet, in denen die Vorlesungen gehalten werden. Bequeme Sitzmöglichkeiten – eher Fehlanzeige. Nichtsdestotrotz wird das Audimax auf Grund seiner schieren Größe gerne auch für Vorträge, Konzerte oder Filmvorführungen genutzt.
3. Belegbogen
Der Belegbogen! Ein Tummelplatz der interessanten Vorlesungen und Seminare eines Semesters, bei denen du gerne zugehört und mitgemacht hättest, es zeitlich nicht geschafft hast, von denen du aber dennoch behauptest, sie besucht zu haben. Deine Angaben werden nicht nachgeprüft und das, obwohl diese Listen in deinem Studienbuch abgelegt sein müssen, das du zum Ende deines Grundstudiums und vor deinen Abschlussprüfungen vorlegen musst. Viel wichtiger sind deine darin abgehefteten Scheine, also die meist benoteten Leistungsnachweise, die du dir durch Hausarbeiten und Klausuren in den Seminaren erarbeitet hast.
4. Campus
Lateinisch für „Feld“ ist mit dem Wort Campus das Universitätsgelände gemeint. Denn häufig sind die unterschiedlichen Hochschulgebäude zentral beieinander angesiedelt. Kurze Wege für schnelle Ortswechsel. Ob die Umgebung schön und einladend ist oder eher abschreckend wirkt, ist unterschiedlich. Allerdings gibt es auch Bildungsstätten, deren einzelne Fakultäten über die ganze Stadt verteilt sind und die somit keinen „echten“ Campus haben. Fakultäten sind übrigens Verwaltungseinheiten, gegliedert nach den einzelnen Wissenschaftsbereichen der Uni. Sie sind zuständig für die Organisation des Studiums, der Lehre und der Forschung in ihren jeweiligen Fachgebieten.
5. Hiwi
Sinnigerweise müsste es eher „Wihi“ heißen, da es sich um die umgangssprachliche Abkürzung für „wissenschaftliche Hilfskraft“ handelt. Sie unterstützen die Dozenten bei ihrer Arbeit durch Recherchedienste, etc. oder übernehmen Tätigkeiten im Service, etwa in den Bibliotheken. Unterteilt in mit und ohne Abschluss sind Hiwi-Stellen äußerst beliebt, weil sie einem bereits einen ersten Blick hinter die Kulissen akademischer Lehre und Forschung erlauben. Zudem lassen sie sich meist gut mit dem Studium vereinen, sodass du dir nebenher noch etwas Geld dazuverdienen kannst. Voraussetzung ist: Du musst immatrikuliert sein und wenn möglich schon ein paar Semester hinter dir haben. Was uns direkt zum nächsten Wort bringt.
6. Immatrikulation
Immatrikulation nennt man die Einschreibung, nach der du offiziell dein Studium antreten kannst. Dazu brauchst du diverse Unterlagen wie Personalausweis und Zeugnis. Bitte bloß nichts vergessen! Die Schlange ist meist recht lang und du willst dich doch nicht wieder hinten anstellen müssen. Außerdem gibt es gewisse Fristen, die du wahren musst. Warst du erfolgreich, bist du anschließend stolzer Besitzer eines Studierendenausweises mit deiner persönlichen Matrikelnummer. Sie ist quasi deine „Hundemarke“ und begleitet dich durch dein ganzes Studium. Los wirst du sie erst wieder, wenn du dich exmatrikulierst, also ausschreibst. Dann wirst du von der Liste der Studenten gestrichen. Das ist der Fall, wenn dein Studium beendet ist, du es abbrichst oder zwangsweise, solltest du etwa verpasst haben deine Semestergebühren zu entrichten.
7. Kolloquium
Eine Art der Lehrveranstaltung meist für Studenten im fortgeschrittenen Semester (ein Studienhalbjahr). Nicht selten dürfen Kolloquien nur auf Einladung des abhaltenden Professors besucht werden. Wie der Name schon sagt (colloquium = „Gespräch“, „Unterredung“) wird in einer Art Gesprächs- oder Diskussionsrunde ein zuvor vorgestelltes Thema näher erörtert. Als Vorbereitung auf die Abschlussarbeit oder –prüfung nahezu unerlässlich.
8. Kommilitonen
Auch hinter diesem Wort, das nichts weiter als deine Mitstudenten bezeichnet, verbirgt sich ein lateinischer Ursprung. „Commilito“ bedeutet übersetzt „Mitstreiter“, „Weggefährte“ oder „Kriegskamerad“. Gemeint ist also eine zusammengehörende Gruppe, die sich von den Studienkollegen im selben Kurs bis hin zu allen Studierenden der Uni erstrecken kann. Bereits im 16. Jahrhundert war der Begriff Kommilitone fest in der Studentensprache verankert. Im 20. Jahrhundert entstand dann auch eine weibliche Version, die Kommilitonin.
9. Prüfungsordnung
Die Prüfungsordnung ist quasi die Bibel des Studenten. Denn sie weiß Rat in allen Lebenslagen und eine Antwort auf alle Fragen. So sagt sie dir nicht nur, welche Prüfungen du ablegen musst und wie der genaue Ablauf ist, sondern auch wie deine schriftliche Abschlussarbeit auszusehen hat, welche Scheine du zuvor vorlegen musst und wie lange die Regelstudienzeit für dein Fach oder deine Fächer ist. Das ist die Zeit, in der du dein Studium idealerweise absolviert haben solltest. In der Praxis sieht es jedoch meist anders aus. Viele Studierende brauchen länger – aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber keine Angst, es handelt sich dabei – wie gesagt – eher um eine Richtlinie, die du mit Abschaffung der Studiengebühr ohne schlechtes Gewissen überschreiten darfst.
10. Vorlesungsverzeichnis
DER Bestseller vor Beginn eines jeden neuen Semesters ist das kommentierte Vorlesungsverzeichnis, kurz KVV. Schließlich verschafft dir seine Lektüre den genauen Überblick über sämtliche Vorlesungen und Kurse, die angeboten werden. Welcher Dozent, wann, wo, was von dir erwartet wird, Literaturtipps zur Vorbereitung und – ganz wichtig – bis wann du dich angemeldet haben musst, steht alles drin. Auch wie viele Credit Points (ECTS = European Credit Transfer System) eine Veranstaltung bringt, ist vermerkt. Dieses Punktesystem erlaubt eine „Umrechnung“ und damit die Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen. An dieser Stelle ein Tipp für Erstsemester und alle, die es nicht besser wissen: Es reicht vollkommen, wenn du dir die Exemplare deiner Fächer besorgst. Du musst nicht das Komplettwerk nehmen, in dem die Veranstaltungen aller Studiengänge aufgelistet sind.
Natürlich ist der „Hochschulslang“ mit diesen zehn Wörtern nicht einmal annähernd ausgeschöpft, sie sollten jedoch reichen, damit du dich in deiner Anfangszeit problemlos zurechtfindest und nicht sofort als „Ersti“ erkannt wirst. Einmal verinnerlicht werden sie dich durch dein ganzes Leben begleiten, auch wenn du außerhalb des Studiums nicht viel mit ihnen anfangen kannst. Zum Angeben sind sie allemal gut. Sollte beispielsweise einer deiner immatrikulierten Kommilitonen beim Kolloquium im Audimax auf dem Campus behaupten Latein sei eine tote Sprache, kannst du ihn sogleich eines Besseren belehren.
Uni-ABC Teil 1: Von A wie Asta bis H wie Hiwi
Kommentar: Wunderbar, Du möchtest einen Kommentar zu "Bitte was? – 10 Wörter die dir nur im Studium begegnen" schreiben.
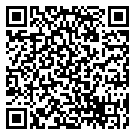
> Mit den richtigen Farben zum Lernerfolg
> Bildungskredite: So lassen Sie sich von der Steuer absetzen
> Bildungskredite: So lassen Sie sich von der Steuer absetzen
Minijobs
Studienjournal
© 4 PM production | shutterstock.com
Stehst du vor dem Beginn deines Studiums und fragst dich, wie du das alles finanzieren sollst? Viele Studenten nehmen...
© GaudiLab | shutterstock.com
Für tausende junger Abiturienten, stellt sich Jahr für Jahr, dieselbe Frage: Was soll ich studieren? Die Wahl eines...
© Rawpixel.com | shutterstock.com
Wer jeden Tag zur Uni geht, sich durch zahlreiche Vorlesungen und Seminare kämpft und bis nachts über den Büchern...
Bewerbungstipps
© wavebreakmedia / shutterstock.com
Mit dem Studienbeginn folgt oft die Suche nach einem Minijob, schließlich will das Studentenleben finanziert werden. Ob...
© wavebreakmedia / shutterstock.com
Das Studium neigt sich dem Ende zu und es fehlt eigentlich nur noch die Abschlussarbeit. Der Einstieg in die Arbeitswelt...
© wavebreakmedia / shutterstock.com
Viele kennen das: Man bewirbt sich für mehrere Stellen, schickt zig Bewerbungen ab und am Ende kommt doch nichts dabei...
Weiterführende Informationen
Ähnliche Artikel finden? Suchen Sie weiter mit Google:
