© R. Fassbind / shutterstock.com
Allgemeine Informationen zum Studium
In der Schweiz unterteilt sich das akademische Jahr in zwei Semester. Die Zeiträume für ein Studienjahr sind in der Schweiz einheitlich geregelt. So beginnt das Wintersemester in der 38. Kalenderwoche (etwa Mitte September) und endet dann mit der 51. Kalenderwoche. Das Sommersemester läuft von der 8. bis zur 22. Kalenderwoche. In der Regel startet das Studium im Wintersemester, jedoch ist die Aufnahme ins Sommersemester an einigen Universitäten ebenfalls möglich
Da in der Schweiz die Bologna-Reform noch nicht vollständig umgesetzt ist, werden an den Hochschulen derzeit noch akademische Titel nach dem alten System verliehen. Demnach erhalten die Studierenden nach vier bis sechs Jahren Vollzeitstudium das „Lizentiat“ oder das „Diplom“, welches mit dem Abschluss des Masters gleichzusetzen ist. Wer dabei sehr gute Abschlussnoten erzielt, ist berechtigt, ein Promotionsstudium anzutreten.
Die Schweizer Hochschulen sind allerdings seit dem Wintersemester 2001/2002 dabei, die Bologna-Deklaration umzusetzen. Dieses zweistufige System führt zum Erwerb der einheitlichen akademischen Titel „Bachelor“ und „Master“.
Sowie in mittlerweile fast allen europäischen Ländern, gilt auch in der Schweiz das sogenannte Kreditpunktesystem, wonach der Erwerb akademischer Titel dass Erreichen einer bestimmten Punktzahl voraussetzt. Pro Semester müssen dabei durchschnittlich 30 Kreditpunkte erworben werden. Der Erwerb des Bachelor-Grads setzt den Erwerb von 180 Kreditpunkten (ECTS) voraus. Somit nimmt das Bachelor-Studium etwa drei Studienjahre in Anspruch. Der erfolgreiche Abschluss des Bachelor-Studiums stellt die Voraussetzung zum Antritt des Aufbaustudiums dar, durch welches dann der akademische Grad „Master“ erzielt werden kann. Für den erfolgreichen Abschluss des Master-Studiums werden zwischen 90 und 120 ECTS benötigt. Das Aufbaustudium dauert in der Regel etwa ein bis zwei Jahre. Inhaber des Master-Titels können ein Promotionsstudium antreten. Für den Erwerb des Doktortitels muss eine Dissertation verfasst werden, die öffentlich zu verteidigen ist. Die Dauer des Promotionsstudiums beträgt etwa zwei bis drei Jahre.
Hochschullandschaft
Das schweizerische Hochschulsystem besteht aus zwei Hochschularten - den Fachhochschulen und den Universitäten, zu denen auch die Eidgenössischen Technischen Hochschulen gezählt werden.
Die 12 universitären Hochschulen setzen sich zusammen aus 10 kantonalen Universitäten und 2 Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die sich in Zürich und Lausanne befinden. Die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen sind dabei auf die Bereiche Ingenieur- und Naturwissenschaft spezialisiert. In der deutschsprachigen Schweiz kann an den Universitäten Basel, Bern, Luzern, St. Gallen sowie Zürich studiert werden. Zu den Universitäten im französischsprachigen Teil der Schweiz gehören die Universitäten in Genf, Lausanne, Neuenburg und die Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Die Universität Freiburg ist dabei deutsch- und französischsprachig. Die Università della Svizzera italiana in Lugano ist die einzige Universität in der italienischsprachigen Schweiz. Das Fächerangebot der universitären Hochschulen lässt sich in folgende Bereiche zusammenfassen: Theologie, Rechtswissenschaft und Kriminalistik, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Geistes, -Sprach- und Sozialwissenschaften, Architektur und Ingenieurwissenschaften, Interdisziplinäre Studiengänge, Pharmazie und Medizin.
Während sich die universitären Hochschulen hauptsächlich mit der Grundlagenforschung befassen, orientieren sich die Fachhochschulen stärker an der beruflichen Praxis. Die Abschlüsse der Fachhochschulen sind aber gleichwertig mit denen der Universitäten. Das Angebot der Fachhochschulen ist dabei sehr vielfältig. So können an diesen Studiengänge in den folgenden Bereichen belegt werden: Technik, Informationstechnologie, Architektur, Bau- und Planungswesen, Chemie, Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft und Dienstleistungen, Gesundheit, Sozialarbeit, Musik, Design, Theater, angewandte Psychologie, angewandte Linguistik und Sport. Darüber hinaus zählen zu den Fachhochschulen auch die Pädagogischen Hochschulen, an denen die Lehramtsausbildung erfolgt.
Weitere private Hochschulen sowie die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) mit Regionalzentren in Basel, Bern und Zürich ergänzen das schweizerische Studienangebot.
Voraussetzungen / Aufnahmekriterien für das Studium
Grundvoraussetzung für eine Zulassung an den Universitäten und eidgenössischen Technischen Hochschulen ist die Allgemeine Hochschulreife, welches das ausländische Äquivalent zur schweizerischen Maturität darstellt. An den Fachhochschulen gilt die Berufsmaturität bzw. die Fachhochschulreife als Zulassungsvoraussetzung. Da die schweizerischen Universitäten hohen Wert auf eine gute Allgemeinbildung der Bewerber legen, kann es jedoch sein, dass die deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufgrund der Fächerkombinationen im Abitur als nicht ausreichend angesehen wird. Ist dies der Fall, muss man sich zusätzlich der schweizerischen oder kantonalen Maturitätsprüfung unterziehen.
Darüber hinaus verlangen die Hochschulen gute Kenntnisse in der jeweiligen Unterrichtssprache (Deutsch, Französisch, Italienisch). So müssen an einigen Hochschulen Sprachtests absolviert werden, bevor man zum Studium zugelassen werden kann. Erfreulicherweise werden inzwischen? auch vermehrt Studiengänge in der englischen Sprache angeboten.
Bewerbungsprozedur
Die Bewerbung kann direkt an die entsprechende Universität bzw. Hochschule gesandt werden. Die Anmeldefristen sind je nach Hochschule verschieden, so dass die Einsendefristen für das Wintersemester zwischen dem 15. Februar und dem 31. Juli liegen.
Da die Zulassungsstellen der einzelnen schweizerischen Hochschulen autonom und im Einzelfall darüber bestimmen, unter welchen Voraussetzungen jemand zum Studium zugelassen wird, sollte man sich vor der Bewerbung unbedingt ausführlich bei der entsprechenden Hochschule über die dort geltenden Zulassungskriterien (Vorbildung, Sprachkenntnisse) informieren. Besonderer Abklärung bezüglich der Zulassung bedarf dabei das Studium der medizinischen Richtungen.
Finanzierung (BAföG, Stipendien, Austauschprogramme, Bildungskredit)
Es besteht die Möglichkeit der finanziellen Förderung durch BAföG, Stipendien, Austauschprogramme und Bildungskredite.
Nach dem neuen BAföG-Gesetz können Studenten, die sich für ein Auslandsstudium in der Schweiz entscheiden, von Beginn des Studiums bis zum Erreichen des Abschlusses gefördert werden. In der Regel gelten dabei die gleichen Förderungsvoraussetzungen wie bei einem Studium in Deutschland. Allerdings besteht durch die höheren Förderungssätze bei einer Ausbildung im Ausland die Möglichkeit, dass auch Auszubildende, die im Inland wegen der Höhe des Einkommens ihrer Eltern keine Förderung erhalten., während eines Ausbildungsaufenthaltes im Ausland gefördert werden können.
Eine Reihe von Organisationen, Verbänden und kirchlichen Trägern bieten Stipendien für das Studium im Ausland an. Häufig ist die Vergabe der Stipendien aber an bestimmte Bedingungen geknüpft (z. B. Religions- oder Parteizugehörigkeit; besondere Begabung oder längere Mitgliedschaft). Erste Anlaufstelle rund um das Thema Stipendium ist der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Auch besteht für ausländische Studenten die Möglichkeit, sich in der Schweiz für ein kantonales Stipendium zu bewerben. Der Ansprechpartner ist in diesem Fall die Eidgenössische Stipendienkommission für ausländische Studierende.
Eine weitere Möglichkeit zur Förderung bietet das europäische Bildungsprogramm Erasmus. Im Rahmen dieses Bildungsprogramms können Studierende für die Dauer von drei Monaten bis zu einem vollen Studienjahr im Ausland verbringen und gefördert werden.
Wer sein Studium mithilfe eines Bildungskredits finanzieren möchte, wendet sich an das Bundesministerium für Bildung und Forschung. In der Regel fallen für vergebene Bildungskredite gar keine oder nur geringe Zinsen an.
Studiengebühren
Die Studiengebühren pro Semester sind von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich hoch. So liegen die Studiengebühren für Studenten aus dem Ausland zwischen 500 CHF (ca. 318 ¤) und 4.000 CHF (ca. 2.540 ¤). Die Beiträge müssen dabei jeweils zu Beginn eines Semesters entrichtet werden. Bei Nachweis einer schwierigen finanziellen Lage besteht allerdings die Möglichkeit von den Studiengebühren befreit zu werden.
Visum und Krankenversicherung
EU-Bürger, die in Besitz eines gültigen Personalausweises sind, können problemlos in die Schweiz einreisen. Für längere Aufenthalte ist es jedoch notwendig, eine Aufenthaltsgenehmigung bei der Fremdenpolizei zu beantragen. Bei der zuständigen Polizeibehörde muss dann eine Aufnahmebestätigung von der Hochschule vorgelegt werden. Manchmal wird zusätzlich ein Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel verlangt.
Studierende aus Deutschland können über ihre im Heimatland ansässige Krankenkasse eine „Europäische Krankenversicherungskarte“ (European Health Insurance Card, EHIC) beantragen. Mi dieser Karte können deutsche Studenten dann in der Regel alle Leistungen des schweizerischen Gesundheitswesens in Anspruch nehmen. Im Fall einer ambulanten Behandlung muss der Betrag jedoch zunächst selbst bezahlt werden. Im Regelfall werden die Kosten aber anschließend von der Krankenkasse erstattet. Auf jeden Fall ist es ratsam, sich vor Studienantritt bei der Krankenkasse über die genauen Details des Versicherungsschutzes informieren.
Welche Möglichkeiten bieten sich nach dem Studium?
Wer nach dem Studium in der Schweiz arbeiten möchte, hat im Allgemeinen gute Chancen, rasch eine Anstellung zu finden. Besonders gute Aussichten haben dabei Akademiker, die bereits erste Berufserfahrungen sammeln konnten. Daher ist es vorteilhaft, noch während des Studiums möglichst viele Praktika zu absolvieren.
Eine besonders starke Nachfrage am Schweizer Arbeitsmarkt besteht derzeit nach Akademikern aus den Bereichen Naturwissenschaft, Technische Wissenschaft, Pharmazie und Medizin (besonders Zahn- und Humanmedizin). Aber auch Bau- und Maschinenbauingenieure sowie Sozialarbeiter haben gute Berufsaussichten. Der Bedarf an qualifiziertem Personal aus diesen Bereichen wird mit größter Wahrscheinlichkeit in der Zukunft weiterhin ansteigen.
Anerkennung von Studienleistungen
Aufgrund europäischer Abkommen werden die Abschlüsse „Bachelor“ und „Master“, die nach dem neuen Studiensystem in der Schweiz erworben werden können, europaweit und somit auch in Deutschland in der Regel problemlos anerkannt. Dennoch ist es ratsam, sich noch vor Studienantritt über die jeweiligen Details bezüglich der Anerkennung von Studienleistungen zu informieren.
In der Schweiz unterteilt sich das akademische Jahr in zwei Semester. Die Zeiträume für ein Studienjahr sind in der Schweiz einheitlich geregelt. So beginnt das Wintersemester in der 38. Kalenderwoche (etwa Mitte September) und endet dann mit der 51. Kalenderwoche. Das Sommersemester läuft von der 8. bis zur 22. Kalenderwoche. In der Regel startet das Studium im Wintersemester, jedoch ist die Aufnahme ins Sommersemester an einigen Universitäten ebenfalls möglich
Da in der Schweiz die Bologna-Reform noch nicht vollständig umgesetzt ist, werden an den Hochschulen derzeit noch akademische Titel nach dem alten System verliehen. Demnach erhalten die Studierenden nach vier bis sechs Jahren Vollzeitstudium das „Lizentiat“ oder das „Diplom“, welches mit dem Abschluss des Masters gleichzusetzen ist. Wer dabei sehr gute Abschlussnoten erzielt, ist berechtigt, ein Promotionsstudium anzutreten.
Die Schweizer Hochschulen sind allerdings seit dem Wintersemester 2001/2002 dabei, die Bologna-Deklaration umzusetzen. Dieses zweistufige System führt zum Erwerb der einheitlichen akademischen Titel „Bachelor“ und „Master“.
Sowie in mittlerweile fast allen europäischen Ländern, gilt auch in der Schweiz das sogenannte Kreditpunktesystem, wonach der Erwerb akademischer Titel dass Erreichen einer bestimmten Punktzahl voraussetzt. Pro Semester müssen dabei durchschnittlich 30 Kreditpunkte erworben werden. Der Erwerb des Bachelor-Grads setzt den Erwerb von 180 Kreditpunkten (ECTS) voraus. Somit nimmt das Bachelor-Studium etwa drei Studienjahre in Anspruch. Der erfolgreiche Abschluss des Bachelor-Studiums stellt die Voraussetzung zum Antritt des Aufbaustudiums dar, durch welches dann der akademische Grad „Master“ erzielt werden kann. Für den erfolgreichen Abschluss des Master-Studiums werden zwischen 90 und 120 ECTS benötigt. Das Aufbaustudium dauert in der Regel etwa ein bis zwei Jahre. Inhaber des Master-Titels können ein Promotionsstudium antreten. Für den Erwerb des Doktortitels muss eine Dissertation verfasst werden, die öffentlich zu verteidigen ist. Die Dauer des Promotionsstudiums beträgt etwa zwei bis drei Jahre.
Hochschullandschaft
Das schweizerische Hochschulsystem besteht aus zwei Hochschularten - den Fachhochschulen und den Universitäten, zu denen auch die Eidgenössischen Technischen Hochschulen gezählt werden.
Die 12 universitären Hochschulen setzen sich zusammen aus 10 kantonalen Universitäten und 2 Eidgenössischen Technischen Hochschulen, die sich in Zürich und Lausanne befinden. Die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen sind dabei auf die Bereiche Ingenieur- und Naturwissenschaft spezialisiert. In der deutschsprachigen Schweiz kann an den Universitäten Basel, Bern, Luzern, St. Gallen sowie Zürich studiert werden. Zu den Universitäten im französischsprachigen Teil der Schweiz gehören die Universitäten in Genf, Lausanne, Neuenburg und die Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Die Universität Freiburg ist dabei deutsch- und französischsprachig. Die Università della Svizzera italiana in Lugano ist die einzige Universität in der italienischsprachigen Schweiz. Das Fächerangebot der universitären Hochschulen lässt sich in folgende Bereiche zusammenfassen: Theologie, Rechtswissenschaft und Kriminalistik, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften, Geistes, -Sprach- und Sozialwissenschaften, Architektur und Ingenieurwissenschaften, Interdisziplinäre Studiengänge, Pharmazie und Medizin.
Während sich die universitären Hochschulen hauptsächlich mit der Grundlagenforschung befassen, orientieren sich die Fachhochschulen stärker an der beruflichen Praxis. Die Abschlüsse der Fachhochschulen sind aber gleichwertig mit denen der Universitäten. Das Angebot der Fachhochschulen ist dabei sehr vielfältig. So können an diesen Studiengänge in den folgenden Bereichen belegt werden: Technik, Informationstechnologie, Architektur, Bau- und Planungswesen, Chemie, Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft und Dienstleistungen, Gesundheit, Sozialarbeit, Musik, Design, Theater, angewandte Psychologie, angewandte Linguistik und Sport. Darüber hinaus zählen zu den Fachhochschulen auch die Pädagogischen Hochschulen, an denen die Lehramtsausbildung erfolgt.
Weitere private Hochschulen sowie die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) mit Regionalzentren in Basel, Bern und Zürich ergänzen das schweizerische Studienangebot.
Voraussetzungen / Aufnahmekriterien für das Studium
Grundvoraussetzung für eine Zulassung an den Universitäten und eidgenössischen Technischen Hochschulen ist die Allgemeine Hochschulreife, welches das ausländische Äquivalent zur schweizerischen Maturität darstellt. An den Fachhochschulen gilt die Berufsmaturität bzw. die Fachhochschulreife als Zulassungsvoraussetzung. Da die schweizerischen Universitäten hohen Wert auf eine gute Allgemeinbildung der Bewerber legen, kann es jedoch sein, dass die deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufgrund der Fächerkombinationen im Abitur als nicht ausreichend angesehen wird. Ist dies der Fall, muss man sich zusätzlich der schweizerischen oder kantonalen Maturitätsprüfung unterziehen.
Darüber hinaus verlangen die Hochschulen gute Kenntnisse in der jeweiligen Unterrichtssprache (Deutsch, Französisch, Italienisch). So müssen an einigen Hochschulen Sprachtests absolviert werden, bevor man zum Studium zugelassen werden kann. Erfreulicherweise werden inzwischen? auch vermehrt Studiengänge in der englischen Sprache angeboten.
Bewerbungsprozedur
Die Bewerbung kann direkt an die entsprechende Universität bzw. Hochschule gesandt werden. Die Anmeldefristen sind je nach Hochschule verschieden, so dass die Einsendefristen für das Wintersemester zwischen dem 15. Februar und dem 31. Juli liegen.
Da die Zulassungsstellen der einzelnen schweizerischen Hochschulen autonom und im Einzelfall darüber bestimmen, unter welchen Voraussetzungen jemand zum Studium zugelassen wird, sollte man sich vor der Bewerbung unbedingt ausführlich bei der entsprechenden Hochschule über die dort geltenden Zulassungskriterien (Vorbildung, Sprachkenntnisse) informieren. Besonderer Abklärung bezüglich der Zulassung bedarf dabei das Studium der medizinischen Richtungen.
Finanzierung (BAföG, Stipendien, Austauschprogramme, Bildungskredit)
Es besteht die Möglichkeit der finanziellen Förderung durch BAföG, Stipendien, Austauschprogramme und Bildungskredite.
Nach dem neuen BAföG-Gesetz können Studenten, die sich für ein Auslandsstudium in der Schweiz entscheiden, von Beginn des Studiums bis zum Erreichen des Abschlusses gefördert werden. In der Regel gelten dabei die gleichen Förderungsvoraussetzungen wie bei einem Studium in Deutschland. Allerdings besteht durch die höheren Förderungssätze bei einer Ausbildung im Ausland die Möglichkeit, dass auch Auszubildende, die im Inland wegen der Höhe des Einkommens ihrer Eltern keine Förderung erhalten., während eines Ausbildungsaufenthaltes im Ausland gefördert werden können.
Eine Reihe von Organisationen, Verbänden und kirchlichen Trägern bieten Stipendien für das Studium im Ausland an. Häufig ist die Vergabe der Stipendien aber an bestimmte Bedingungen geknüpft (z. B. Religions- oder Parteizugehörigkeit; besondere Begabung oder längere Mitgliedschaft). Erste Anlaufstelle rund um das Thema Stipendium ist der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). Auch besteht für ausländische Studenten die Möglichkeit, sich in der Schweiz für ein kantonales Stipendium zu bewerben. Der Ansprechpartner ist in diesem Fall die Eidgenössische Stipendienkommission für ausländische Studierende.
Eine weitere Möglichkeit zur Förderung bietet das europäische Bildungsprogramm Erasmus. Im Rahmen dieses Bildungsprogramms können Studierende für die Dauer von drei Monaten bis zu einem vollen Studienjahr im Ausland verbringen und gefördert werden.
Wer sein Studium mithilfe eines Bildungskredits finanzieren möchte, wendet sich an das Bundesministerium für Bildung und Forschung. In der Regel fallen für vergebene Bildungskredite gar keine oder nur geringe Zinsen an.
Studiengebühren
Die Studiengebühren pro Semester sind von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich hoch. So liegen die Studiengebühren für Studenten aus dem Ausland zwischen 500 CHF (ca. 318 ¤) und 4.000 CHF (ca. 2.540 ¤). Die Beiträge müssen dabei jeweils zu Beginn eines Semesters entrichtet werden. Bei Nachweis einer schwierigen finanziellen Lage besteht allerdings die Möglichkeit von den Studiengebühren befreit zu werden.
Visum und Krankenversicherung
EU-Bürger, die in Besitz eines gültigen Personalausweises sind, können problemlos in die Schweiz einreisen. Für längere Aufenthalte ist es jedoch notwendig, eine Aufenthaltsgenehmigung bei der Fremdenpolizei zu beantragen. Bei der zuständigen Polizeibehörde muss dann eine Aufnahmebestätigung von der Hochschule vorgelegt werden. Manchmal wird zusätzlich ein Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel verlangt.
Studierende aus Deutschland können über ihre im Heimatland ansässige Krankenkasse eine „Europäische Krankenversicherungskarte“ (European Health Insurance Card, EHIC) beantragen. Mi dieser Karte können deutsche Studenten dann in der Regel alle Leistungen des schweizerischen Gesundheitswesens in Anspruch nehmen. Im Fall einer ambulanten Behandlung muss der Betrag jedoch zunächst selbst bezahlt werden. Im Regelfall werden die Kosten aber anschließend von der Krankenkasse erstattet. Auf jeden Fall ist es ratsam, sich vor Studienantritt bei der Krankenkasse über die genauen Details des Versicherungsschutzes informieren.
Welche Möglichkeiten bieten sich nach dem Studium?
Wer nach dem Studium in der Schweiz arbeiten möchte, hat im Allgemeinen gute Chancen, rasch eine Anstellung zu finden. Besonders gute Aussichten haben dabei Akademiker, die bereits erste Berufserfahrungen sammeln konnten. Daher ist es vorteilhaft, noch während des Studiums möglichst viele Praktika zu absolvieren.
Eine besonders starke Nachfrage am Schweizer Arbeitsmarkt besteht derzeit nach Akademikern aus den Bereichen Naturwissenschaft, Technische Wissenschaft, Pharmazie und Medizin (besonders Zahn- und Humanmedizin). Aber auch Bau- und Maschinenbauingenieure sowie Sozialarbeiter haben gute Berufsaussichten. Der Bedarf an qualifiziertem Personal aus diesen Bereichen wird mit größter Wahrscheinlichkeit in der Zukunft weiterhin ansteigen.
Anerkennung von Studienleistungen
Aufgrund europäischer Abkommen werden die Abschlüsse „Bachelor“ und „Master“, die nach dem neuen Studiensystem in der Schweiz erworben werden können, europaweit und somit auch in Deutschland in der Regel problemlos anerkannt. Dennoch ist es ratsam, sich noch vor Studienantritt über die jeweiligen Details bezüglich der Anerkennung von Studienleistungen zu informieren.
Kommentar: Wunderbar, Du möchtest einen Kommentar zu "Studieren in der Schweiz" schreiben.
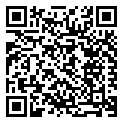
Minijobs
The Light of Life from daihei shibata on Vimeo.
Auslandsstudium
© Boris Stroujko / shutterstock.com
Studieren, wo andere Urlaub machen - Ein Traum für viele Studenten. Insbesondere die Türkei wird deshalb bei vielen...
Ein Auslandsemester ist für viele Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ein fast unerreichbar scheinender Traum. Hohe Kosten und...
© Gr8 / shutterstock.com
In Neuseeland unterteilt sich das akademische Jahr in zwei Semester. Ein Semester umfasst in der Regel etwa 18...
© Jean-Francois Rivard / shutterstock.com
In Südafrika beginnt das Studienjahr im Januar oder Februar und endet im November oder Dezember. Das akademische Jahr...
© Geno EJ Sajko Photography / shutterstock.com
In Großbritannien beginnt das Studienjahr im Oktober und endet im Juni oder Juli des darauffolgenden Jahres. Das...
© idiz / shutterstock.com
Das akademische Jahr untergliedert sich an den meisten Hochschulen in Australien in zwei Semester, wobei ein Semester 18...
© gary718 / shutterstock.com
Allgemeine Informationen zum Studium In den USA unterteilt sich das akademische Jahr je nach Hochschule in 2 bis 4...
© skyfish / shutterstock.com
Allgemeine Informationen zum Studium In Malta untergliedert sich das akademische Jahr in zwei Semester. In der Regel...
© Xuanlu Wang / shutterstock.com
Allgemeine Informationen zum Studium In Kanada beginnt das Studienjahr im September und endet im April des...
© Nejron Photo / shutterstock.com
Allgemeine Informationen zum Studium In Italien unterteilt sich das akademische Jahr in zwei Semester. Das erste...
Studienjournal
© Dragon Images/www.shutterstock.com
Wer sich dazu entscheidet seiner Gesundheit und der Welt in der wir leben gleichermaßen etwas Gutes zu tun, der landet...
© Ditty_about_summer / shutterstock.com
Warum sind Gurken im Supermarkt eigentlich in Folie eingeschweißt? In diversen digitalen Auskunftsdiensten taucht diese...
© Goodluz / shutterstock.com
In den vielen Bachelor-Studiengängen an Fachhochschulen wird irgendwann ein Pflichtpraktikum bzw. die Praxisphase auf...
Studieren im Ausland
Setzen Sie ihre Suche nach Informationen zu "Studieren in der Schweiz" bei Google fort:
